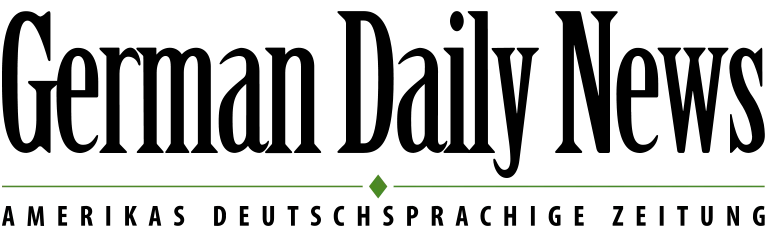Kultur
„Sechzehn Wörter“ am Staatstheater Kassel
Die Macht der Worte

(Quelle: Sylwester Pawliczek)
GDN -
Am vergangenen Freitag feierte die Uraufführung „Sechzehn Wörter“ (basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Nava Ebrahimi) unter der Regie von Dariusch Yazdkhasti Premiere am Staatstheater Kassel und entführte das Publikum in die vielfältige Kultur des Irans.
„Wie groß die Macht der Worte ist, wird selten recht bedacht“, bemerkte der Dramatiker und Lyriker Friedrich Hebbel (1813 - 1863). Wörter können erheitern und deprimieren, verbinden und trennen, trösten und empören. Eine besondere Relevanz kommt bestimmten Worten zu, ist man mit zwei Sprachwelten vertraut, wie es bei Mona, der Protagonistin des Romans „Sechzehn Wörter“, der in Kassel für die Theaterbühne adaptiert wurde, der Fall ist. Von jenen 16 Wörtern ihrer persischen Muttersprache habe sie sich erst befreien können, als sie diese ins Deutsche übersetzt habe. „Durch die Übersetzung hob ich den Bann auf, der auf dem Wort lag, und befreite mich aus der Geiselhaft. Wir waren nun beide frei, das Wort und ich.“
Die ZuschauerInnen in Kassel erfahren im Verlaufe des unterhaltsamen Abends, dass zwei scheinbar gegensätzliche Begriffe wie „beschissen“ und „golden“ dieselbe Bedeutung haben können - „je nachdem, ob man unter sich ist oder nicht.“ „Ab jetzt werde ich jede Kreuzung, über die ich fahre, mit anderen Augen sehen“, denkt sich vielleicht nicht nur Monas Freund, sondern auch mancher im Publikum, nun wissend, dass Kreuzung auf persich „Tschahar-Rah“ (= Vierweg) heißt und die im Stück aufgeworfene Frage, ob das Wort „Dorugh“ (=Lüge) von Trug stammt oder es genau andersherum ist und „Dorugh“ zuerst da war, mag eine inspirierende Überlegung sein.
Mona ist gebürtige Iranerin, lebt jedoch seit ihrer Kindheit in Deutschland, wo sie als Ghostwriterin für einen (zu) viel beschäftigen Ghostwriter arbeitet und somit einen Beruf ausübt, der ihre Identität gleich mehrfach verschleiert. Infolge des Todes ihrer Großmutter begibt sie sich auf eine Reise in den Iran - eine flirrende Expedition zu Stätten ihrer Vergangenheit, zu ihren Wurzeln, zu unausgesprochenen Wahrheiten und letztlich zu sich selbst.
Die in Teheran geborene Nava Ebrahimi hat mit ihrem preisgekrönten Debütroman, der die Geschichte von Mona anhand von 16 persischen Wörtern, die die einzelnen Kapitel überschreiben, erzählt, die Vorlage für das Theaterstück geschaffen. In einem Interview gab die Autorin Einblicke in ihre Schreibmotivation. „Vielleicht wollte ich darüber schreiben, wie es wird, wenn man sich zu sehr bemüht, sich möglichst schnell zu integrieren und in die neue Gesellschaft einzufügen.“ Vergesse man dabei seine eigene Kultur, könne dies Schaden anrichten und zur Entwurzelung führen. Im Verlaufe ihrer Reise wird Mona klar: „Man sollte besser in der Heimat bleiben und essen, was die Vorfahren aßen. Für Wanderschaft zahlt man einen hohen Preis. Mehr als das, was gefälschte Pässe und Fluchthelfer kosten.“
Regisseur Dariusch Yazdkhasti, der bereits 2022 in Kassel Kristof Magnussons „Ein Mann der Kunst“ inszeniert hat, wählt zur Einstimmung auf die Geschichte eine Diavorführung mit Bildern aus dem Iran, bei dem das Publikum in Gespräche über das Land einbezogen wird - ein gelungener Ansatz, was sich auch darin widerspiegelt, dass die ZuschauerInnen über den Abend auffallend lebhaft und aufgeschlossen erscheinen.
Die bestehende Textvorlage stellt eine Theaterinszenierung vor einige Herausforderungen. Es handelt sich um einen Reiseroman mit zahlreichen Ortswechseln, die stets ein schwieriges Unterfangen bei einer Bühnenadaption darstellen. Zudem wird keine geschlossene Geschichte mit einem dramaturgischen Rahmen erzählt, sondern vielmehr werden einzelne Situationen und Dialoge anekdotenhaft aneinandergereiht. Diese sind gleichsam unterhaltsam, witzig, poetisch wie auch ambivalent und es gelingt der Inszenierung aus ihnen nach und nach ein Gesamtbild entstehen zu lassen.
Julia Hattstein hat ein Bühnenbild aus transparenten, beweglichen Fadenvorhängen entworfen, die Räume definieren als auch als Leinwand für effektvolle Videoeinspielungen dienen, wodurch die variierenden Umgebungen angedeutet werden.
Julia Hattstein hat ein Bühnenbild aus transparenten, beweglichen Fadenvorhängen entworfen, die Räume definieren als auch als Leinwand für effektvolle Videoeinspielungen dienen, wodurch die variierenden Umgebungen angedeutet werden.
Mittels weniger Requisiten schlüpfen die beteiligten SchauspielerInnen teils im Minutentakt in diverse Rollen und wissen dank ihrer spürbaren Spielfreude zu überzeugen. Katharina Brehl verwandelt sich mit viel Verve in die verschiedensten Figuren, Emma Bahlmann weiß vor allem durch ihr komödiantisches Talent zu begeistern und Nicolas Sidiropulos konnte als Gastschauspieler die Verantwortlichen dazu bewegen, ihn ab der kommenden Spielzeit als festes Ensemblemitglied am Staatstheater Kassel zu engagieren.
„Ich wünsche mir, dass meine Leserschaft ein Gefühl dafür bekommt, wie anders das soziale Miteinander im Iran ist und welch besondere Intimität Frauen miteinander haben“, hebt Nava Ebrahimi, der es mit ihrem Text gelungen ist, die Sinnlichkeit und Lebensfreude des Irans einzufangen, hervor.
Dieses scheint auch der Inszenierung am Staatstheater Kassel gelungen zu sein, wie die Reaktion des Publikums zeigt, das mit großem Applaus und Standing Ovations auf die Aufführung reagiert hat. Es war erfreulich zu erleben, dass dieses zunehmend vielfältiger zusammengesetzt ist, und vereinzelt Menschen mit iranischen Wurzeln, die den Abend wahrnehmbar bereichert haben, unter den ZuschauerInnen zu sehen waren. Diese erfrischende Entwicklung ist ein Verdienst der Intendanz von Florian Lutz, aber auch der ausgeschiedenen Schauspieldirektorin Patricia Nickel-Dönicke und ein großer Gewinn für das kulturelle Leben sowie ein wertvoller Beitrag für das Miteinander in Kassel.
Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.